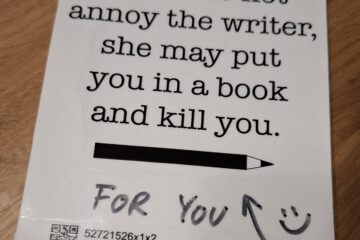Buch-Countdown #8: Der aktuelle Bezug
„Und nun steht Taina sich selbst gegenüber, sieht das verlorengegangene, unerreichbare Ufer in sich, das Land, das einmal zu ihr gehört hat, und das sie nicht mehr betreten darf, weil Henning es so bestimmt hat. Nicht nur Staaten rauben einander Territorien, Menschen tun es genauso – und behaupten hinterher, sie Weiterlesen