„Als Taina von so nahem in seine Augen sieht, passiert etwas mit ihr. Ein Gefühl, als würde irgendwo in den muffigen Teilen ihres Bewusstseins ein Fenster aufgerissen. Eine kräftige Brise strömt durch ihre Erinnerung und bläst eine dicke Schicht Staub weg, der nun vor ihrem inneren Auge wirbelt, sich langsam setzt und den Blick auf das freigibt, was er über lange Zeit verdeckt hat.“
– Das Haus am Ende der Welt, S. 91
Kürzlich schickte mir eine Autorenkollegin diesen Aufkleber:
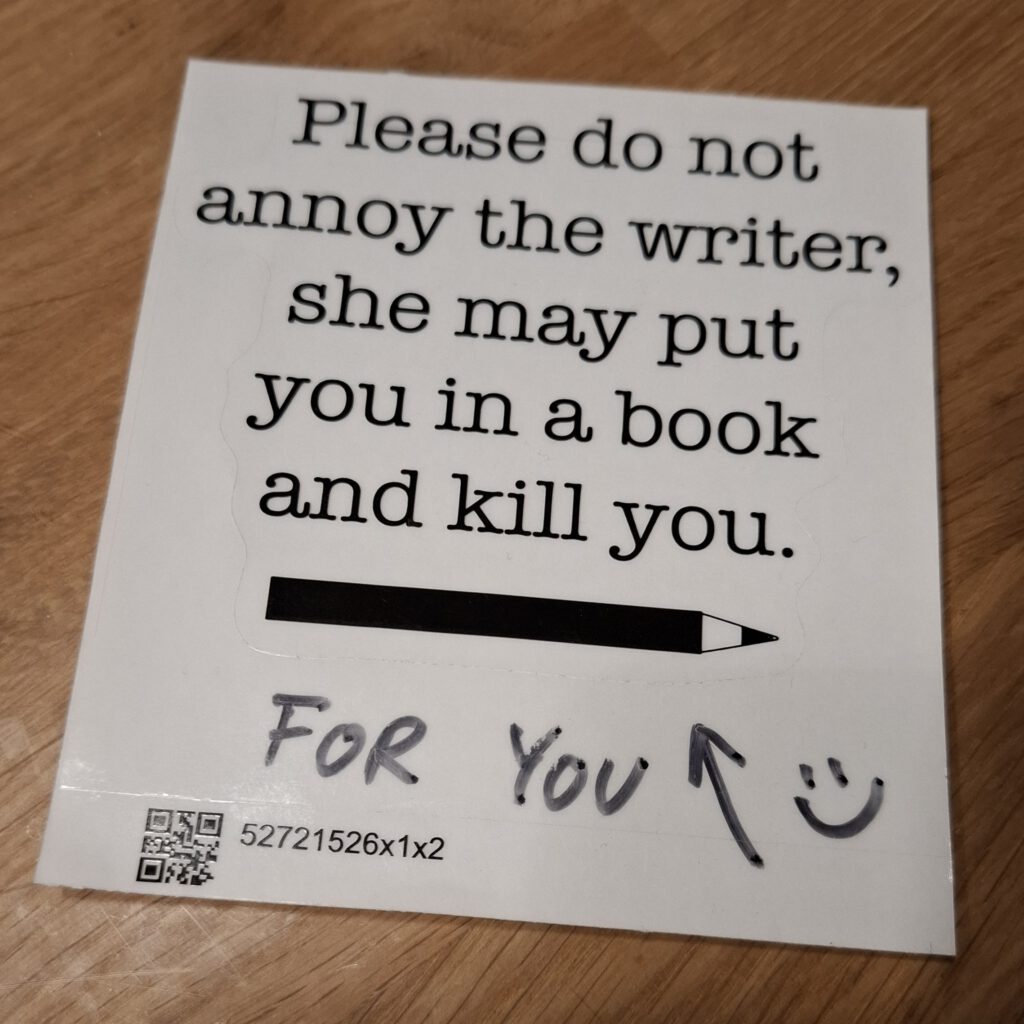
Diese Warnung hängt nun an meinem Kühlschrank, keine zwei Meter entfernt von dem Ort, an dem ich den größten Teil von Das Haus am Ende der Welt geschrieben habe.
Immer wieder werde ich gefragt: Haben meine Romanfiguren reale Vorbilder? Und wie viel von mir selbst steckt in den Figuren?
Diese Frage lässt sich nicht eindeutig beantworten. In Das Haus am Ende der Welt ist von allem etwas dabei. Jede der Hauptfiguren trägt Anteile von mir, aber anderes an ihnen entspricht mir überhaupt nicht. Auch in manchen Nebenfiguren finde ich mich wieder, in anderen hingegen gar nicht. Manche Figuren haben reale Vorbilder, wie etwa ein Grenzbeamter, der eine kleine Rolle spielt. Bei einer anderen Figur hatte ich eine finnische Popsängerin vor Augen, die ich eine Zeit lang gerne gehört habe, die hierzulande aber unbekannt ist. Einige Figuren sind komplett auf meinem inneren Reißbrett entstanden. Manche begleiten mich schon lange, unabhängig von der Geschichte, andere sind erst sehr kurzfristig hinzugekommen. Und ja, in zwei Fällen bediene ich mich sogar bei Figuren aus Schattenwald.

Den sarkastischen Kriminalkommissar Jens Pieroth, der Sara gehörig auf die Nerven geht, habe ich kurzerhand zum Bruder meines Protagonisten Henning gemacht – ein Einfall, über den ich sehr glücklich bin. Jens stellt sich als wichtiger Katalysator heraus, der den manchmal etwas bräsigen Henning zum Handeln zwingt. Außerdem hat mir diese Enfant-terrible-Figur mit der großen Schnauze einfach Spaß gemacht zu schreiben.
Grundsätzlich ist es so, dass mir zunächst die Figuren einfallen, bevor sich überhaupt eine Art von Geschichte abzeichnet. Sie begleiten mich über lange Zeit. So war es bei der Mutter-Tochter-Konstellation aus Eva und Sara in Schattenwald, und so ist es auch bei dem Vater-Tochter-Duo aus Henning und Mai in Das Haus am Ende der Welt. Lange bevor sich eine Handlung entwickelt, fangen die Figuren in meiner Vorstellung an zu leben.
Zu Beginn herrscht zwischen diesen beiden Charakteren totale Harmonie. Solange dieser Zustand anhält, bleibt eine Geschichte jedoch in weiter Ferne, denn ohne Konflikte, ohne gegensätzliche Wünsche, ohne ein gegeneinander Arbeiten gibt es keine Handlung. Diese entsteht erst, wenn ich ein Element finde, das die beiden Figuren entzweit, sodass sie an gegensätzliche Pole geraten. Jede wird zum Antagonisten der anderen. Dann kann ich mit der Geschichte arbeiten.
Literatur ist ein Vehikel, innere Zustände in sprachliche Bilder zu übersetzen, die von anderen verstanden werden. Die Identifikation mit den Figuren gelingt, wenn Leserinnen und Leser eigene Konflikte in ihnen wiedererkennen. Deshalb hat Identifikation weniger mit dem Geschlecht, Alter oder der sozialen Stellung der Protagonisten zu tun, als es zunächst scheint. Es sind nicht die äußeren Hüllen des 47-jährigen Henning oder der 15-jährigen Mai, die beim Lesen Resonanz erzeugen, sondern ihre Konflikte und Dilemmata. Meine Aufgabe als Schriftstellerin ist es, Figuren zu erschaffen, in denen Leserinnen und Leser Motive aus ihrem eigenen Leben wiederfinden.
Wenn ich eine Geschichte plane, sind meine Protagonisten also schon lange da – und zugleich auch wieder nicht. Anfangs sind sie noch blass, doch im Laufe des Planungs- und Schreibprozesses erreichen sie den Punkt, an dem sie ein Eigenleben entwickeln. Sie schütteln gewissermaßen alle Harmonie und Idealisierung ab und beginnen, Seiten zu zeigen, die ich nicht unbedingt mag oder gutheiße. Weder Henning noch Mai sind im fertigen Buch die Menschen, die ich anfangs im Sinn hatte. Sie sind rauer, fehlerhafter und oftmals sogar unsympathischer, als ich sie mir ausgemalt hatte. Und das ist genau richtig so. Wenn sie sich im Laufe der Handlung von meinen Idealvorstellungen emanzipieren, fangen sie an, zu leben und eigenständig zu werden. Deshalb bedaure und feiere ich es zugleich, wenn sie plötzlich Macken entwickeln. So muss es sein.
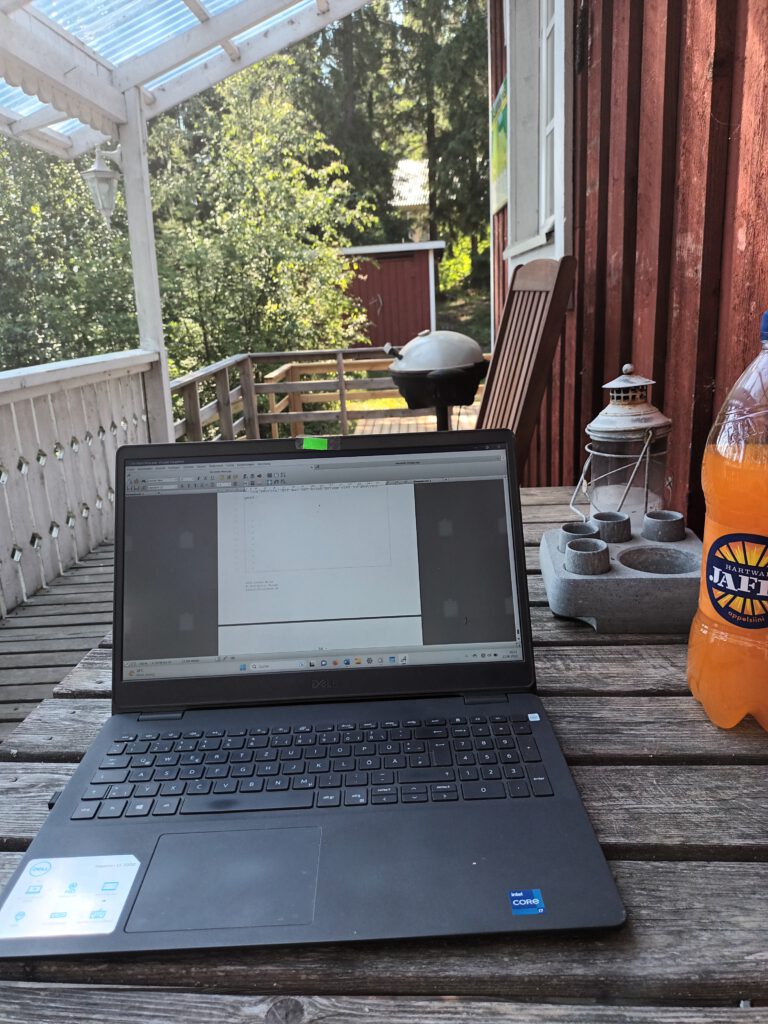
Ein weiterer schöner Nebeneffekt: Je mehr Eigenleben die Figuren entwickeln, desto mehr Stoff bieten sie an, der es am Ende nicht in die Geschichte schafft. Das ist einerseits schade (Stichwort: „Kill Your Darlings“), andererseits sorgt es dafür, dass die Figuren am Ende nicht „auserzählt“ sind. Wie geht es am Ende von Schattenwald nun mit Sara und Ramin weiter? Oder mit Leonie? Wird sich Sara mit ihrer Mutter versöhnen, oder entzweit das Erlebte sie noch mehr? In den Köpfen der Leserinnen und Leser leben die Figuren weiter. So wird es auch bei Das Haus am Ende der Welt sein.
Übrigens denke ich über all diese Fragen auch selbst immer wieder nach, denn wenn das Buch geschrieben ist, verschwinden die Figuren, die mich so lange begleitet haben, nicht einfach. Vielleicht formuliere ich ja eines Tages neue Antworten für sie.
Fotos: (c) Katrin Faludi



0 Kommentare